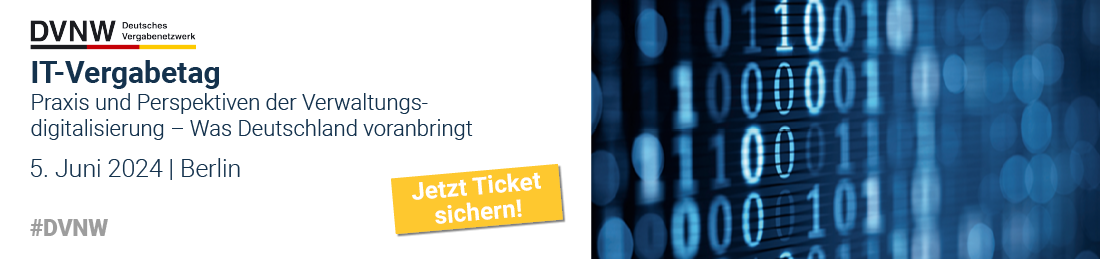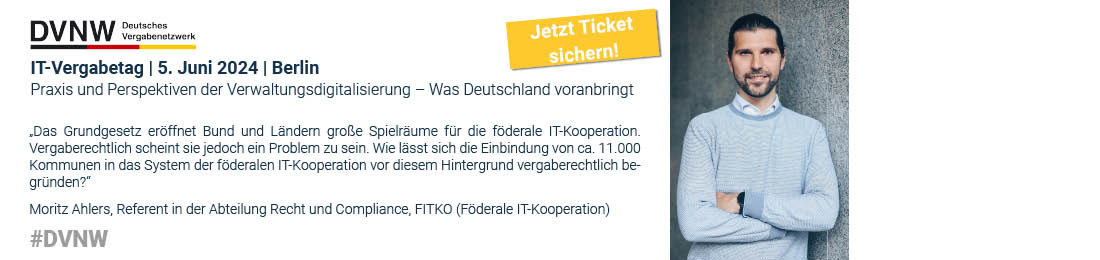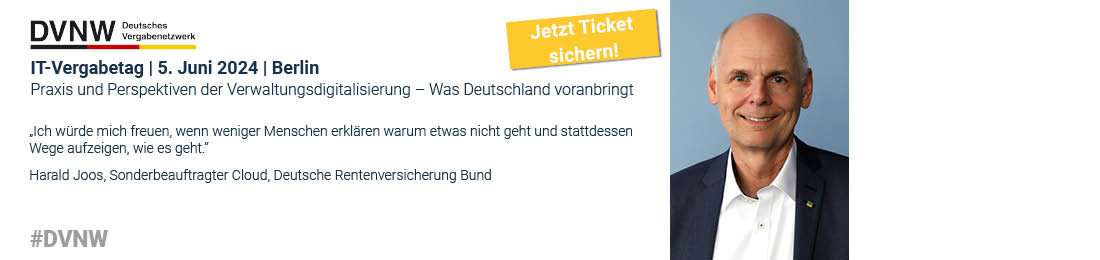Vergabeblog
"Hier lesen Sie es zuerst"Recht | Politik&Markt | Leistungen | Bau | ITK | Verkehr |Verteidigung | Health
EuGH für Bieterausschluss bei unterschrittener Mindestpunktzahl (EuGH, Urt. v. 20.9.2018 – C-546/16 – „Montte SL“)
 Nach mehr als zwei Jahren seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2014/24/EU hat der EuGH erstmals zum neuen Vergaberecht entschieden. Die Luxemburger Richter haben zu einem offenen Verfahren geurteilt, wonach im Rahmen der Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes das zwingende Erreichen einer Mindestpunktzahl bei einem technischen Zuschlagskriterium Voraussetzung für die abschließende Preisbewertung der Angebote war. Den gesamten Beitrag lesen »
Nach mehr als zwei Jahren seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2014/24/EU hat der EuGH erstmals zum neuen Vergaberecht entschieden. Die Luxemburger Richter haben zu einem offenen Verfahren geurteilt, wonach im Rahmen der Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes das zwingende Erreichen einer Mindestpunktzahl bei einem technischen Zuschlagskriterium Voraussetzung für die abschließende Preisbewertung der Angebote war. Den gesamten Beitrag lesen »
1 Kommentar
Ausschreibungspflicht für Wasserkonzessionen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.6.2018 – VI-2 U 7/16 [Kart])
 Für den Abschluss von Wasserkonzessionsverträgen gelten die Vergabevorschriften nach Teil 4 des GWB (§§ 97-184 GWB) nicht. Diese Bereichsausnahme ist ausdrücklich in § 149 Nr. 9 GWB normiert. Für Wasserkonzessionen sind damit weder das GWB-Vergaberecht noch die KonzVgV als Verfahrensregeln zwingend anzuwenden. Wasserkonzessionen sind aber in keinem rechtsfreien Raum zu vergeben. Zwar gilt für sie kein sektor- bzw. fachspezifisches Vergaberecht, wie dies z.B. für Strom- und Gaskonzessionen nach dem EnWG der Fall ist. Allerdings können verfahrensbezogene und materielle Anforderungen u.a. aus dem europäischen Primärrecht und dem Kartellrecht erwachsen. Den gesamten Beitrag lesen »
Für den Abschluss von Wasserkonzessionsverträgen gelten die Vergabevorschriften nach Teil 4 des GWB (§§ 97-184 GWB) nicht. Diese Bereichsausnahme ist ausdrücklich in § 149 Nr. 9 GWB normiert. Für Wasserkonzessionen sind damit weder das GWB-Vergaberecht noch die KonzVgV als Verfahrensregeln zwingend anzuwenden. Wasserkonzessionen sind aber in keinem rechtsfreien Raum zu vergeben. Zwar gilt für sie kein sektor- bzw. fachspezifisches Vergaberecht, wie dies z.B. für Strom- und Gaskonzessionen nach dem EnWG der Fall ist. Allerdings können verfahrensbezogene und materielle Anforderungen u.a. aus dem europäischen Primärrecht und dem Kartellrecht erwachsen. Den gesamten Beitrag lesen »
Kein automatischer Ausschluss von Konzernunternehmen (EuGH, Urt. v. 17.5.2018 – C-531/16 – Specializuotas transportas)
 Wenn sich zwei oder mehrere konzernverbundene Unternehmen an einem Vergabeverfahren mit verschiedenen Angeboten beteiligen, kann der vergaberechtliche Geheimwettbewerb gefährdet sein. Öffentliche Auftraggeber sind daher häufig mit besonderen Vergabefragen konfrontiert. Den gesamten Beitrag lesen »
Wenn sich zwei oder mehrere konzernverbundene Unternehmen an einem Vergabeverfahren mit verschiedenen Angeboten beteiligen, kann der vergaberechtliche Geheimwettbewerb gefährdet sein. Öffentliche Auftraggeber sind daher häufig mit besonderen Vergabefragen konfrontiert. Den gesamten Beitrag lesen »
Wann gilt EU-Recht bei Unterschwellenvergaben? (EuGH, Urt. v. 20.3.2018 – C-187/16 – „Österreichische Staatsdruckerei“)
 Für öffentliche Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte sind die Grundregeln des AEUV, insbesondere der Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit) zu beachten, wenn an diesen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse besteht. Wann ein solcher Binnenmarktbezug aber konkret vorliegt und öffentliche Auftraggeber deshalb europarechtliche Vergabevorgaben bei der Beschaffung berücksichtigen müssen, ist immer wieder Gegenstand gerichtlicher Verfahren. So urteilte die Große Kammer des EuGH im Fall der direkten Beauftragung der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH zur Herstellung von sog. Pyrotechnik-Ausweisen: Den gesamten Beitrag lesen »
Für öffentliche Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte sind die Grundregeln des AEUV, insbesondere der Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit) zu beachten, wenn an diesen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse besteht. Wann ein solcher Binnenmarktbezug aber konkret vorliegt und öffentliche Auftraggeber deshalb europarechtliche Vergabevorgaben bei der Beschaffung berücksichtigen müssen, ist immer wieder Gegenstand gerichtlicher Verfahren. So urteilte die Große Kammer des EuGH im Fall der direkten Beauftragung der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH zur Herstellung von sog. Pyrotechnik-Ausweisen: Den gesamten Beitrag lesen »
Dickes Ding: Unterschwellige Konzessionsvergabe ohne Vorabinformation und Wartefrist nichtig? (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.12.2017 – 27 U 25/17)
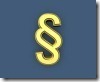 Das OLG Düsseldorf hat nun im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens wegen der Vergabe einer Unterschwellenkonzession in einem obiter dictum die Ansicht geäußert, dass gewichtige Gründe dafür sprächen, auch im Unterschwellenbereich die Einhaltung einer Informations- und Wartepflicht durch den öffentlichen Auftraggeber zu verlangen. Diese Rechtsauffassung ist diskutabel. Den gesamten Beitrag lesen »
Das OLG Düsseldorf hat nun im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens wegen der Vergabe einer Unterschwellenkonzession in einem obiter dictum die Ansicht geäußert, dass gewichtige Gründe dafür sprächen, auch im Unterschwellenbereich die Einhaltung einer Informations- und Wartepflicht durch den öffentlichen Auftraggeber zu verlangen. Diese Rechtsauffassung ist diskutabel. Den gesamten Beitrag lesen »
1 Kommentar
Sind Inhouse-Unternehmen automatisch öffentliche Auftraggeber? (EuGH, Urt. v. 05.10.2017 – C-567/15 LitSpecMet)
 Bei öffentlich beherrschten Tochtergesellschaften stellt sich häufig die Frage, ob sie selbst Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 2 GWB (Einrichtung des öffentlichen Rechts) sind. Hierbei ist vor allem zu klären, ob das Tochterunternehmen im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art erfüllt. Manche unterstellen insoweit, dass schon die Wahrnehmung von allgemeinen Interessen bei der Mutter(gesellschaft) ausreichen würde, das Tochterunternehmen entsprechend zu infizieren. Der EuGH ist einer solchen Infizierung bereits in seinem Mannesmann-Urteil vom 15.01.1998 (Rs. C-44/96) entgegengetreten. Was aber gilt, wenn die Mutter(gesellschaft) für die Erfüllung ihrer im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben auf ihr „inhouse“ beauftragtes Tochterunternehmen angewiesen ist? Den gesamten Beitrag lesen »
Bei öffentlich beherrschten Tochtergesellschaften stellt sich häufig die Frage, ob sie selbst Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 2 GWB (Einrichtung des öffentlichen Rechts) sind. Hierbei ist vor allem zu klären, ob das Tochterunternehmen im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art erfüllt. Manche unterstellen insoweit, dass schon die Wahrnehmung von allgemeinen Interessen bei der Mutter(gesellschaft) ausreichen würde, das Tochterunternehmen entsprechend zu infizieren. Der EuGH ist einer solchen Infizierung bereits in seinem Mannesmann-Urteil vom 15.01.1998 (Rs. C-44/96) entgegengetreten. Was aber gilt, wenn die Mutter(gesellschaft) für die Erfüllung ihrer im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben auf ihr „inhouse“ beauftragtes Tochterunternehmen angewiesen ist? Den gesamten Beitrag lesen »
EuGH verschärft erneut Regeln für Unterschwellenvergaben (EuGH, Urt. v. 05.04.2017 – C-298/15 Borta)
 Bei Unterschwellenvergaben gilt das europäische Primärrecht, wenn an den öffentlichen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse besteht. In diesem Fall sind die Grundregeln des AEUV zu beachten, vor allem Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz. Liegt ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse vor, stellt sich die Frage nach den hieraus folgenden Verfahrensanforderungen. Dazu zählt seit jeher z.B. die Pflicht zur Gewährleistung eines angemessenen Grades an Öffentlichkeit, sprich zur Bekanntmachung. Für europarechtswidrig haben die Luxemburger Richter aber jüngst die Anforderung eingeordnet, dass die ausgeschriebenen Leistungen auch hauptsächlich vom Auftragnehmer auszuführen sind. Den gesamten Beitrag lesen »
Bei Unterschwellenvergaben gilt das europäische Primärrecht, wenn an den öffentlichen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse besteht. In diesem Fall sind die Grundregeln des AEUV zu beachten, vor allem Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz. Liegt ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse vor, stellt sich die Frage nach den hieraus folgenden Verfahrensanforderungen. Dazu zählt seit jeher z.B. die Pflicht zur Gewährleistung eines angemessenen Grades an Öffentlichkeit, sprich zur Bekanntmachung. Für europarechtswidrig haben die Luxemburger Richter aber jüngst die Anforderung eingeordnet, dass die ausgeschriebenen Leistungen auch hauptsächlich vom Auftragnehmer auszuführen sind. Den gesamten Beitrag lesen »
Rechtssicher de-facto vergeben? Die freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach § 135 Abs. 3 GWB (VK Westfalen, Beschl. v. 28.02.2017 – VK 1 – 02/17; nicht bestandskräftig)
 § 135 Abs. 3 GWB enthält eine im vergangenen Jahr neu in das GWB eingefügte Vorschrift. Sie setzt erstmals Art. 2d RL 89/665/EWG bzw. RL 92/13/EWG, jeweils in der Fassung der RL 2007/66/EG, in deutsches Recht um. Danach ist ein vergebener Auftrag nicht unwirksam, wenn Den gesamten Beitrag lesen »
§ 135 Abs. 3 GWB enthält eine im vergangenen Jahr neu in das GWB eingefügte Vorschrift. Sie setzt erstmals Art. 2d RL 89/665/EWG bzw. RL 92/13/EWG, jeweils in der Fassung der RL 2007/66/EG, in deutsches Recht um. Danach ist ein vergebener Auftrag nicht unwirksam, wenn Den gesamten Beitrag lesen »
Rechtssicher de-facto vergeben? Die freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach § 135 Abs. 3 GWB (VK Westfalen, Beschl. v. 28.02.2017 VK 1 – 02/17)
 § 135 Abs. 3 GWB enthält eine im vergangenen Jahr neu in das GWB eingefügte Vorschrift. Sie setzt erstmals Art. 2d RL 89/665/EWG bzw. RL 92/13/EWG, jeweils in der Fassung der RL 2007/66/EG, in deutsches Recht um. Danach ist ein vergebener Auftrag nicht unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber Den gesamten Beitrag lesen »
§ 135 Abs. 3 GWB enthält eine im vergangenen Jahr neu in das GWB eingefügte Vorschrift. Sie setzt erstmals Art. 2d RL 89/665/EWG bzw. RL 92/13/EWG, jeweils in der Fassung der RL 2007/66/EG, in deutsches Recht um. Danach ist ein vergebener Auftrag nicht unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber Den gesamten Beitrag lesen »
Das Ende der Aufgreifschwellen? Oder: Wann muss der Angebotspreis aufgeklärt werden? (EuG, Urt. v. 26.01.2017 – T-700/14 TV1/Kommission)
 Ein ungewöhnlich/unangemessen niedriges Angebot darf nicht bezuschlagt werden. Das regeln die § 60 Abs. 3 VgV und § 16d EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A. Erscheint der Preis eines Angebotes deshalb ungewöhnlich/unangemessen niedrig, so muss der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung verlangen und es näher prüfen (§ 60 Abs. 1 und 2 VgV, § 16d EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A). Hierfür haben weite Teile der deutschen Vergaberechtsprechung sog. „Aufgreifschwellen“ entwickelt, bei deren Erreichen der Auftraggeber verpflichtet ist, den Angebotspreis eingehend aufzuklären und zu prüfen. Den gesamten Beitrag lesen »
Ein ungewöhnlich/unangemessen niedriges Angebot darf nicht bezuschlagt werden. Das regeln die § 60 Abs. 3 VgV und § 16d EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A. Erscheint der Preis eines Angebotes deshalb ungewöhnlich/unangemessen niedrig, so muss der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung verlangen und es näher prüfen (§ 60 Abs. 1 und 2 VgV, § 16d EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A). Hierfür haben weite Teile der deutschen Vergaberechtsprechung sog. „Aufgreifschwellen“ entwickelt, bei deren Erreichen der Auftraggeber verpflichtet ist, den Angebotspreis eingehend aufzuklären und zu prüfen. Den gesamten Beitrag lesen »
EuGH zu inhouse-schädlichen Drittumsätzen (EuGH, Urt. v. 08.12.2016 – C-553/15 – Undis Servizi)
 Vergaberechtsfreie Inhouse-Aufträge sind spätestens seit dem Teckal-Urteil des EuGH (Urt. v. 18.11.1999 – C-107/98) von großer praktischer Bedeutung. Zahlreiche öffentliche Auftraggeber nutzen das Inhouse-Geschäft um vergaberechtliche Anforderungen beim Einkauf von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen legal zu vermeiden. Den gesamten Beitrag lesen »
Vergaberechtsfreie Inhouse-Aufträge sind spätestens seit dem Teckal-Urteil des EuGH (Urt. v. 18.11.1999 – C-107/98) von großer praktischer Bedeutung. Zahlreiche öffentliche Auftraggeber nutzen das Inhouse-Geschäft um vergaberechtliche Anforderungen beim Einkauf von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen legal zu vermeiden. Den gesamten Beitrag lesen »
Wann besteht ein grenzüberschreitendes Interesse bei Unterschwellenvergaben? (EuGH, Urt. v. 6.10.2016–Rs. C-318/15 – Tecnoedi Construzioni)
 Bei der Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich gilt das europäische Primärrecht. Das gilt aber nur, sofern bei diesen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse festzustellen ist. Dann sind die Grundregeln des AEUV, insbesondere der Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz zu beachten. Den gesamten Beitrag lesen »
Bei der Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich gilt das europäische Primärrecht. Das gilt aber nur, sofern bei diesen Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse festzustellen ist. Dann sind die Grundregeln des AEUV, insbesondere der Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz zu beachten. Den gesamten Beitrag lesen »
Zuschlagskriterien im Unterschwellenbereich: Keine Bekanntgabe, keine Transparenz nötig? (BGH, Beschl. v. 10.05.2016 – X-ZR 66/15)
 Die VOB/A 2016 verlangt in ihrem 1. Abschnitt – anders als § 16d Abs. 2 Nr. 2 VOB/A-EU 2016 im 2. Abschnitt – keine förmliche Angabe der einzelnen Wertungskriterien in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen. Im Gegensatz zum 1. Abschnitt der VOB/A 2016 verpflichtet hingegen § 16 Abs. 7 VOL/A (1. Abschnitt) den Auftraggeber die Zuschlagskriterien spätestens in den Vergabeunterlagen zu nennen.
Die VOB/A 2016 verlangt in ihrem 1. Abschnitt – anders als § 16d Abs. 2 Nr. 2 VOB/A-EU 2016 im 2. Abschnitt – keine förmliche Angabe der einzelnen Wertungskriterien in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen. Im Gegensatz zum 1. Abschnitt der VOB/A 2016 verpflichtet hingegen § 16 Abs. 7 VOL/A (1. Abschnitt) den Auftraggeber die Zuschlagskriterien spätestens in den Vergabeunterlagen zu nennen.
EuGH zum Bieterwechsel bei Insolvenz eines BiGe-Mitglieds (EuGH, Urt. v. 24.05.2016 – C-396/14 MT Hojgaard und Züblin)
 Zur Wahrung eines fairen und transparenten Vergabewettbewerbs ist es grundsätzlich unzulässig, nach Angebotsabgabe die Identität des Bieters zu ändern: Zum Inhalt eines Angebotes zählt nicht nur die Beschaffenheit der Leistung, sondern auch die Den gesamten Beitrag lesen »
Zur Wahrung eines fairen und transparenten Vergabewettbewerbs ist es grundsätzlich unzulässig, nach Angebotsabgabe die Identität des Bieters zu ändern: Zum Inhalt eines Angebotes zählt nicht nur die Beschaffenheit der Leistung, sondern auch die Den gesamten Beitrag lesen »
EuGH schränkt Eignungsleihe ein (EuGH, Urt. v. 07.04.2016, Rs. C-324/14 – Partner Apelski Dariusz)
 Bewerber und Bieter können sich zum Nachweis ihrer Eignung grundsätzlich auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen (Eignungsleihe). Diese Regel kennt aber Ausnahmen. So können der Auftragsgegenstand und die damit verfolgten Ziele derart besonders sein, dass eine Eignungsleihe nur dann möglich ist, wenn das Drittunternehmen unmittelbar und persönlich an der Auftragsausführung beteiligt ist, so der EuGH. Den gesamten Beitrag lesen »
Bewerber und Bieter können sich zum Nachweis ihrer Eignung grundsätzlich auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen (Eignungsleihe). Diese Regel kennt aber Ausnahmen. So können der Auftragsgegenstand und die damit verfolgten Ziele derart besonders sein, dass eine Eignungsleihe nur dann möglich ist, wenn das Drittunternehmen unmittelbar und persönlich an der Auftragsausführung beteiligt ist, so der EuGH. Den gesamten Beitrag lesen »
EuGH gegen Formstrenge bei Eignungsleihe (EuGH, Urt. v. 14.1.2016 – Rs. C-234/14 – ‘Ostas Celtnieks’)
 Bieter, die sich zum Nachweis ihrer Eignung auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen (Eignungsleihe), müssen vor dem Zuschlag z.B. weder einen Kooperationsvertrag mit diesen Unternehmen abschließen noch eine gemeinsame Gesellschaft gründen. Solche einschränkenden (Form-)Vorgaben in den Vergabeunterlagen zum Nachweis bei der Eignungsleihe verstoßen gegen europäisches Vergaberecht, so der EuGH. Den gesamten Beitrag lesen »
Bieter, die sich zum Nachweis ihrer Eignung auf die Kapazitäten anderer Unternehmen stützen (Eignungsleihe), müssen vor dem Zuschlag z.B. weder einen Kooperationsvertrag mit diesen Unternehmen abschließen noch eine gemeinsame Gesellschaft gründen. Solche einschränkenden (Form-)Vorgaben in den Vergabeunterlagen zum Nachweis bei der Eignungsleihe verstoßen gegen europäisches Vergaberecht, so der EuGH. Den gesamten Beitrag lesen »
Teilnahmeverbot für öffentliche Unternehmen? (EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – Rs. C-203/14 – Consorci Sanitari del Maresme)
 Die Große Kammer des EuGH hatte im Rahmen eines spanischen Vorabentscheidungsersuchens u.a. über die Teilnahme öffentlicher Stellen an Vergabeverfahren zu entscheiden. Rechtlicher Anknüpfungspunkt war vor allem Art. 1 Abs. 8 UAbs. 1 und 2 RL 2004/18/EG (ähnlich: Art. 2 Nr. 10 RL 2014/24/EU). Den gesamten Beitrag lesen »
Die Große Kammer des EuGH hatte im Rahmen eines spanischen Vorabentscheidungsersuchens u.a. über die Teilnahme öffentlicher Stellen an Vergabeverfahren zu entscheiden. Rechtlicher Anknüpfungspunkt war vor allem Art. 1 Abs. 8 UAbs. 1 und 2 RL 2004/18/EG (ähnlich: Art. 2 Nr. 10 RL 2014/24/EU). Den gesamten Beitrag lesen »
1 Kommentar
VK-Gebühren von höchstens 2% des Auftragswertes? (EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – Rs. C-61/14 Orizzonte Salute)
 Nach der Rechtsschutz-RL 89/665/EWG müssen für den Fall von Verstößen gegen das EU-Vergaberecht oder gegen einzelstaatliche Umsetzungsvorschriften, Möglichkeiten einer wirksamen und raschen Nachprüfung bestehen. Die RL 89/665/EWG belässt den Mitgliedstaaten ein Ermessen bei der Wahl der vorgesehenen Verfahrensgarantien und der entsprechenden Formalitäten. Den gesamten Beitrag lesen »
Nach der Rechtsschutz-RL 89/665/EWG müssen für den Fall von Verstößen gegen das EU-Vergaberecht oder gegen einzelstaatliche Umsetzungsvorschriften, Möglichkeiten einer wirksamen und raschen Nachprüfung bestehen. Die RL 89/665/EWG belässt den Mitgliedstaaten ein Ermessen bei der Wahl der vorgesehenen Verfahrensgarantien und der entsprechenden Formalitäten. Den gesamten Beitrag lesen »
OLG Stuttgart zum einstweiligen Rechtsschutz bei Unterschwellenvergaben (OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.7.2015 – 10 W 31/15)
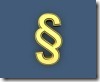 Primärer Rechtsschutz bei Auftragsvergaben unterhalb der europäischen Vergabeschwellenwerte kann regelmäßig – abgesehen von besonderen landesrechtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten, z.B. in Sachsen-Anhalt – vor den ordentlichen Gerichten gewährt werden. Den gesamten Beitrag lesen »
Primärer Rechtsschutz bei Auftragsvergaben unterhalb der europäischen Vergabeschwellenwerte kann regelmäßig – abgesehen von besonderen landesrechtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten, z.B. in Sachsen-Anhalt – vor den ordentlichen Gerichten gewährt werden. Den gesamten Beitrag lesen »
1 Kommentar
EuGH verschärft Regeln für Unterschwellenvergaben (EuGH, Urt. v. 16.4.2015 – Rs. C-278/14)
 Öffentliche Auftraggeber müssen bei der Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich das europäische Primärrecht beachten. Dies gilt aber nur, sofern ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse am Auftrag besteht. Zu beachten sind dann die Grundregeln des AEUV, insbesondere die Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz. Den gesamten Beitrag lesen »
Öffentliche Auftraggeber müssen bei der Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich das europäische Primärrecht beachten. Dies gilt aber nur, sofern ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse am Auftrag besteht. Zu beachten sind dann die Grundregeln des AEUV, insbesondere die Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), sowie die sich daraus ergebenden allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz. Den gesamten Beitrag lesen »