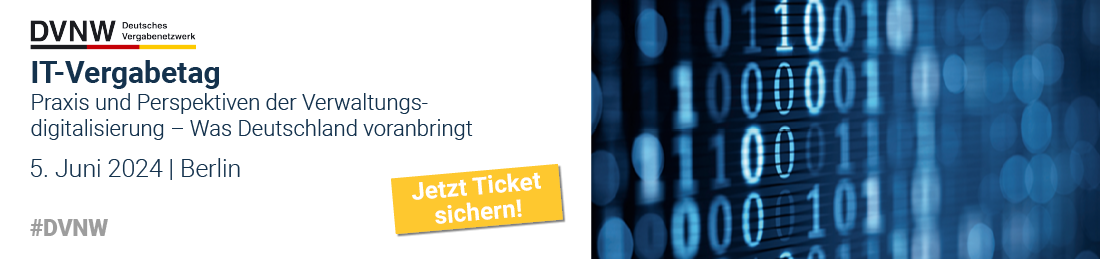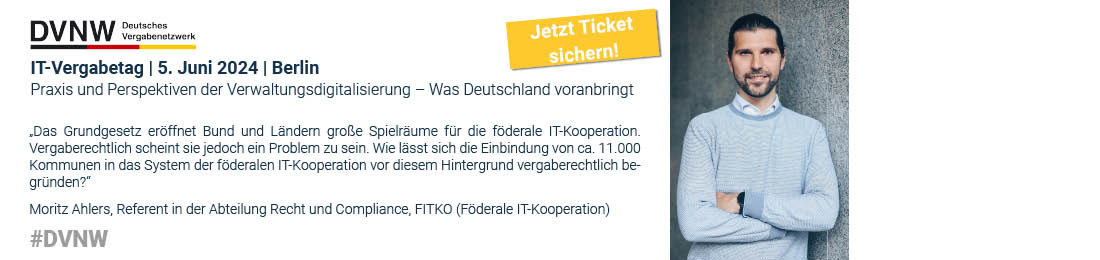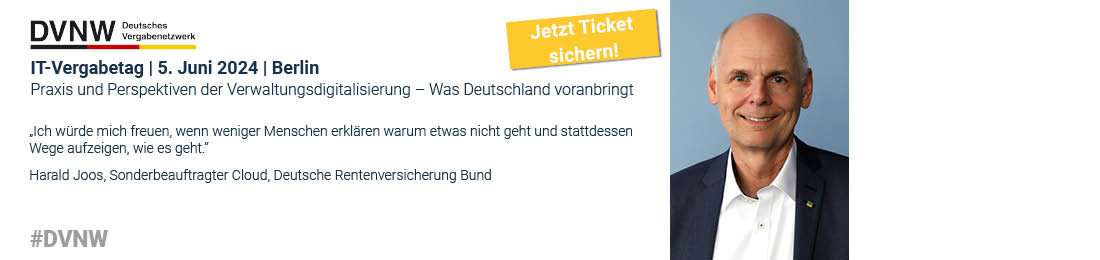Vergabeblog
"Fundiert, praxisnah, kontrovers"Recht | Politik&Markt | Leistungen | Bau | ITK | Verkehr |Verteidigung | Health
Stromkonzessionen: Treu und Glauben bestimmen das Vergabeverfahren
 1. Bei der Vergabe von Stromkonzessionen haben die Bieter einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf diskriminierungsfreie und sachliche gerechtfertigte Durchführung des Ausschreibungsverfahrens.
1. Bei der Vergabe von Stromkonzessionen haben die Bieter einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf diskriminierungsfreie und sachliche gerechtfertigte Durchführung des Ausschreibungsverfahrens.
2. Der Bieter muss im Ausschreibungsverfahren erkannte Rechtsverstöße unverzüglich rügen.
3. Gelangt ein Bieter auf nicht offiziellem Wege an ein Gutachten, auf welches er seine Rüge stützt, ist zweifelhaft, ob er als zuverlässiger Verhandlungs- und Vertragspartner eines langfristigen Konzessionsvertrages in Betracht kommt.
3 Kommentare
Vergabe der Alttextilentsorgung als Dienstleistungskonzession (BGH, Beschluss v. 23.01.2012 – Az. X ZB 5/11)
 Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen durch einen öffentlichen Auftraggeber unterfällt nicht dem GWB Vergaberecht, da es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag nach § 99 GWB handelt (BGH, Beschluss vom 23.01.2012 – Az. X ZB 5/11). Zu beachten sind allein die Vorgaben des europäischen Primärrechts. Daher ist die Abgrenzung zwischen der Dienstleistungskonzession und dem Dienstleistungsauftrag, der dem GWB Vergaberecht unterliegt, bedeutend. Sie verliert auch aufgrund ihres Ausnahmecharakters nicht an Aktualität. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Vereinbarungen zwischen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und Unternehmen bezüglich der Sammlung und Verwertung von Alttextilien.
Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen durch einen öffentlichen Auftraggeber unterfällt nicht dem GWB Vergaberecht, da es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag nach § 99 GWB handelt (BGH, Beschluss vom 23.01.2012 – Az. X ZB 5/11). Zu beachten sind allein die Vorgaben des europäischen Primärrechts. Daher ist die Abgrenzung zwischen der Dienstleistungskonzession und dem Dienstleistungsauftrag, der dem GWB Vergaberecht unterliegt, bedeutend. Sie verliert auch aufgrund ihres Ausnahmecharakters nicht an Aktualität. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Vereinbarungen zwischen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und Unternehmen bezüglich der Sammlung und Verwertung von Alttextilien.
Zuschlag ohne Wartefrist bei Gas-Konzessionsvergaben möglich (LG Köln, Urteil v. 22.3.2013 – 90 O 51/13)
 In seinem Urteil vom 22.3.2013 – 90 O 51/13 – hat das LG Köln in einem einstweiligen Verfügungsverfahren u.a. festgestellt, dass bei der Vergabe eines Gas-Konzessionsvertrages, eben so wie bei der öffentlichen Auftragsvergabe im Unterschwellenbereich, keine Wartefrist analog § 101a GWB zu beachten ist.
In seinem Urteil vom 22.3.2013 – 90 O 51/13 – hat das LG Köln in einem einstweiligen Verfügungsverfahren u.a. festgestellt, dass bei der Vergabe eines Gas-Konzessionsvertrages, eben so wie bei der öffentlichen Auftragsvergabe im Unterschwellenbereich, keine Wartefrist analog § 101a GWB zu beachten ist.
1 Kommentar
Opposition warnt vor Privatisierungsbestrebungen auf EU-Ebene bei der Wasserversorgung – „Wasser ist keine Handelsware!“
Anlässlich der Diskussion mehrerer EU-Vorlagen zur Wasserwirtschaft haben die Fraktionen von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen erneut vor einer Privatisierung der Wasserversorgung gewarnt. In der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses vergangenen Mittwoch (20.03.2013) wies Waltraut Wolff (SPD) auf eine Mitteilung der EU-Kommission hin, in der von einer „Stärkung des Innovations- und Wettbewerbspotenziale der europäischen Wasserwirtschaft“ die Rede sei. „Das stört mich“, sagte die SPD-Abgeordnete.
2 Kommentare
Bundestag: Opposition warnt vor Privatisierung der Wasserversorgung – erste kritische Stimmen aus der Regierungsfraktion
 Die Auswirkungen der geplanten EU-Konzessionsrichtlinie auf die deutsche Wasserversorgung sind von den Oppositionsfraktionen und der Bundesregierung völlig unterschiedlich beurteilt worden. In die kritischen Stimmen reihte sich in einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des Bundestages am vergangenen Mittwoch, den 13.3.2013, auch die CDU/CSU-Fraktion ein, die der EU-Kommission unter anderem vorwarf, mit dem Richtlinien-Entwurf die Interessen französischer Großkonzerne im Blick zu haben.
Die Auswirkungen der geplanten EU-Konzessionsrichtlinie auf die deutsche Wasserversorgung sind von den Oppositionsfraktionen und der Bundesregierung völlig unterschiedlich beurteilt worden. In die kritischen Stimmen reihte sich in einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des Bundestages am vergangenen Mittwoch, den 13.3.2013, auch die CDU/CSU-Fraktion ein, die der EU-Kommission unter anderem vorwarf, mit dem Richtlinien-Entwurf die Interessen französischer Großkonzerne im Blick zu haben.
Strategische Partnerschaften und Rekommunalisierung der Netze – zum Beschluss des OLG Düsseldorf vom 04.02.2013 – Verg 31/12
 Ebenso wie in dem bereits im Vergabeblog besprochenen Beschluss des OLG Düsseldorf vom 09.01.2013 (VII-Verg 26/12) ging es auch im vorliegenden Fall um die Beteiligung eines strategischen Partners an einer Gemeindewerke-Gesellschaft. Die Gründung der Gemeindewerke ebenso wie die Suche nach einem strategischen Partner erfolgten vor dem Hintergrund der geplanten Rekommunalisierung von Versorgungsnetzen (Wasser und Strom) im Gemeindegebiet.
Ebenso wie in dem bereits im Vergabeblog besprochenen Beschluss des OLG Düsseldorf vom 09.01.2013 (VII-Verg 26/12) ging es auch im vorliegenden Fall um die Beteiligung eines strategischen Partners an einer Gemeindewerke-Gesellschaft. Die Gründung der Gemeindewerke ebenso wie die Suche nach einem strategischen Partner erfolgten vor dem Hintergrund der geplanten Rekommunalisierung von Versorgungsnetzen (Wasser und Strom) im Gemeindegebiet.
Live-Übertragung im Vergabeblog: Diskussion zur EU-Konzessionsrichtlinie
 Wie angekündigt finden Sie nachfolgend die Live-Übertragung einer Diskussion zur EU-Konzessionsrichtlinie, u.a. mit Sabine Verheyen, MdEP (CDU/EVP), Burkhard Dlugosch (Facebook Initiative “Wasser darf nicht privatisiert werden”) sowie Vertreter eines privaten Anbieters von Wasserversorgungsleistungen. Zeit: Donnerstag, 7. März, 10.00-11.00 Uhr.
Wie angekündigt finden Sie nachfolgend die Live-Übertragung einer Diskussion zur EU-Konzessionsrichtlinie, u.a. mit Sabine Verheyen, MdEP (CDU/EVP), Burkhard Dlugosch (Facebook Initiative “Wasser darf nicht privatisiert werden”) sowie Vertreter eines privaten Anbieters von Wasserversorgungsleistungen. Zeit: Donnerstag, 7. März, 10.00-11.00 Uhr.
SPD-Bundestagsfraktion: Keine Ausschreibungspflicht bei Wasserversorgung
Nach den GRÜNEN stimmt nun auch die SPD-Bundestagsfraktion mit ein: Die Bundesregierung soll kommunale Versorgungsunternehmen stärken und die formale Ausschreibungspflicht bei Dienstleistungskonzessionen besonders im Bereich der Wasserversorgung ablehnen. Dies fordert sie in einem Antrag (17/12519), der am heutigen Donnerstag auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages stand.
Bundestag: Bündnis 90/Die Grünen wollen „Privatisierung“ der Wasserversorgung durch die EU stoppen
 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt sich gegen eine „Privatisierung der Wasserversorgung durch die Hintertür“. Wenn Pläne der EU-Kommission zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen umgesetzt würden, würde es vielfach zu Preiserhöhungen und mittelfristig zu Qualitätsverlusten bei der Wasserversorgung kommen“, heißt es in einem Antrag der Fraktion (17/12394), der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht. Bemerkenswerter Schachzug: Die Fraktion beruft sich dabei auf einen Beschluss des CDU-Bundesparteitags.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt sich gegen eine „Privatisierung der Wasserversorgung durch die Hintertür“. Wenn Pläne der EU-Kommission zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen umgesetzt würden, würde es vielfach zu Preiserhöhungen und mittelfristig zu Qualitätsverlusten bei der Wasserversorgung kommen“, heißt es in einem Antrag der Fraktion (17/12394), der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht. Bemerkenswerter Schachzug: Die Fraktion beruft sich dabei auf einen Beschluss des CDU-Bundesparteitags.
Der Entwurf einer Konzessionsrichtlinie als Gefahr für die deutsche Trinkwasserversorgung?
Ein Gastbeitrag von Simone Terbrack, M.A., und Bac.jur. Sarah Schadendorf
 Die Europäische Union wolle „das Wasser privatisieren“, so lautet eine derzeit in den Medien und der deutschen Politik häufig geäußerte Befürchtung, der auch in der Europäischen Bürgerinitiative right2water Ausdruck verliehen wird. Anlass für die Proteste ist der von der EU-Kommission ausgearbeitete Entwurf für eine Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, über den zuletzt am 24. Januar 2013 im Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments abgestimmt wurde. Tatsächlich verfolgt die EU-Kommission sowohl auf EU- als auch auf GATS-Ebene seit Jahren eine Liberalisierungsstrategie für wasserbezogene Dienstleistungen. Was genau also soll die geplante Richtlinie regeln und was würde sich an der bestehenden Rechtslage ändern?
Die Europäische Union wolle „das Wasser privatisieren“, so lautet eine derzeit in den Medien und der deutschen Politik häufig geäußerte Befürchtung, der auch in der Europäischen Bürgerinitiative right2water Ausdruck verliehen wird. Anlass für die Proteste ist der von der EU-Kommission ausgearbeitete Entwurf für eine Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, über den zuletzt am 24. Januar 2013 im Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments abgestimmt wurde. Tatsächlich verfolgt die EU-Kommission sowohl auf EU- als auch auf GATS-Ebene seit Jahren eine Liberalisierungsstrategie für wasserbezogene Dienstleistungen. Was genau also soll die geplante Richtlinie regeln und was würde sich an der bestehenden Rechtslage ändern?
6 Kommentare
OLG Düsseldorf gibt neuen Rechtsrahmen für Energiekooperationen und Konzessionsvergaben vor (Beschluss v. 9.01.2013 – VII-Verg 26/12)
Ein Gastbeitrag von RA Jens Biemann, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
 Bieter trifft auch bei der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen eine Hinweispflicht auf erkennbare Rechtsverstöße im Wettbewerbsverfahren. Später können sie sich darauf nicht mehr berufen. Neben dieser auftraggeberfreundlichen Vorgabe stellt der Vergabesenat des OLG Düsseldorf erstmals seinen Standpunkt zu Rekommunalisierungsverfahren im Energiesektor und Konzessionsvergaben nach § 46 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dar (Beschluss vom 9.01.2013 – VII-Verg 26/12).
Bieter trifft auch bei der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen eine Hinweispflicht auf erkennbare Rechtsverstöße im Wettbewerbsverfahren. Später können sie sich darauf nicht mehr berufen. Neben dieser auftraggeberfreundlichen Vorgabe stellt der Vergabesenat des OLG Düsseldorf erstmals seinen Standpunkt zu Rekommunalisierungsverfahren im Energiesektor und Konzessionsvergaben nach § 46 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dar (Beschluss vom 9.01.2013 – VII-Verg 26/12).
Schluss mit Lustig: Bundeskartellamt untersagt Konzessionsvergabe der Stadt Mettmann für Strom- und Gasnetze
Das Bundeskartellamt hat der Stadt Mettmann, Kreisstadt des gleichnamigen Kreises im Regierungsbezirk Düsseldorf, untersagt, die Wegerechte für den Betrieb des Strom- und Gasnetzes „inhouse“ an ihr eigenes Tochterunternehmen zu vergeben. Die Stadt hatte zunächst im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens einen Kooperationspartner mit einer Minderheitsbeteiligung für ihr neu zu gründendes Stadtwerk gesucht. Dieses kommunale Stadtwerk sollte dann ohne Auswahlverfahren die Konzession für die Strom- und Gasnetze erhalten. Obacht – gegenwärtig begleitet das Amt weitere Auswahlverfahren, u.a. in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Leipzig.
EU-Richtlinie zu Konzessionen: Kommunale Spitzenverbände und Verband Kommunaler Unternehmen fordern Anwendungsbeschränkung und Nachbesserung
Gemeinsam wenden sich die kommunalen Spitzenverbände und der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) gegen die Pläne der EU-Kommission, Dienstleistungskonzessionen der Ausschreibungspflicht zu unterwerfen. Die Kommission hatte vor einem Jahr, am 20.12.2011, ihren Vorschlag für eine Konzessionsrichtlinie veröffentlicht. „Diese Richtlinie würde erheblich in die kommunale Organisationsfreiheit im Bereich der Daseinsvorsorge eingreifen“, so die beiden Verbände. Ein europarechtlich vorgegebenes Verfahren würde an die Stelle der Entscheidungen der kommunalen Gremien vor Ort gestellt, z.B. bei der Vergabe einer Wasserkonzession in der Kommune. Der zuständige Binnenmarktkommissar, Michel Barnier, hatte sich vergangene Woche in Berlin zu diesen Kritikpunkten mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU ausgetauscht. Dabei haben sich die Verbände auf drei wesentliche Punkte konzentriert.
Ausschuss der Regionen der EU: Deutliche Stellungnahme zur Konzessionsrichtlinie
 Die Aufgabe des EU-Ausschusses der Regionen (AdR) besteht darin, den Standpunkt der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Rechtsvorschriften der EU einzubringen. EU-Kommission, -Rat und -Parlament müssen den Ausschuss anhören. Am 13.09.2012 hat der AdR eine Stellungnahme (2012/C 277/09) zur geplanten EU-Richtlinie zur Konzessionsvergabe abgegeben, die dem Kommissionsentwurf deutliche Grenzen setzen will.
Die Aufgabe des EU-Ausschusses der Regionen (AdR) besteht darin, den Standpunkt der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Rechtsvorschriften der EU einzubringen. EU-Kommission, -Rat und -Parlament müssen den Ausschuss anhören. Am 13.09.2012 hat der AdR eine Stellungnahme (2012/C 277/09) zur geplanten EU-Richtlinie zur Konzessionsvergabe abgegeben, die dem Kommissionsentwurf deutliche Grenzen setzen will.
OLG Brandenburg: Dienstleistungskonzession unzulässig, Nachprüfungsantrag begründet! (OLG Brandenburg, B. v. 28.08.2012 – Verg W 19/11)
Ein Gastbeitrag von RA Torben Schustereit, GKMP Pencereci Rechtsanwälte
 Die Dienstleistungskonzession beschäftigt auch das Vergaberecht bereits seit geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen. Dabei ist für ihre Vergabe der Rechtsweg zu den Vergabekammern und –senaten gar nicht eröffnet – meinte man. Zu den hierzu ergangenen Entscheidungen hat sich nunmehr eine neue gesellt, mit der das OLG Brandenburg Neuland betritt.
Die Dienstleistungskonzession beschäftigt auch das Vergaberecht bereits seit geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen. Dabei ist für ihre Vergabe der Rechtsweg zu den Vergabekammern und –senaten gar nicht eröffnet – meinte man. Zu den hierzu ergangenen Entscheidungen hat sich nunmehr eine neue gesellt, mit der das OLG Brandenburg Neuland betritt.
BGH: Vergabenachprüfungsinstanzen sind bei gesetzeswidriger Dienstleistungskonzession zuständig (BGH, Beschluss v. 18.06.2012 – X ZB 9/11)
 Nach Rechtsprechung des BGH fällt die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen (DLK) an sich nicht in den Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB. Folge hiervon ist, dass für die Vergabe von DLKen nicht der Rechtsweg zu Vergabekammer und Vergabesenat besteht. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf soll jedoch anderes für den Fall gelten, wenn die Vergabe von Aufträgen nur als öffentlicher Auftrag erfolgen darf und der öffentliche Auftraggeber stattdessen rechtwidriger Weise einen anderen Auftragstyp, nämlich eine DLK wählt. Es ist vergleichbar wie bei De-facto-Vergaben auch in einem derartigen Fall Aufgabe der Vergabenachprüfungsinstanzen, die Einhaltung des Vergaberechts durchzusetzen. Soweit demnach die Vergabe eines Auftrags nur als ein dem Vergaberecht unterliegender Dienstleistungsauftrag und nicht als DLK vergeben werden kann, sind die Vergabenachprüfungsinstanzen zuständig. Insofern hat das OLG Düsseldorf den Rechtsweg zu den Vergabenachprüfungsinstanzen für zulässig erklärt, jedoch die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen.
Nach Rechtsprechung des BGH fällt die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen (DLK) an sich nicht in den Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB. Folge hiervon ist, dass für die Vergabe von DLKen nicht der Rechtsweg zu Vergabekammer und Vergabesenat besteht. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf soll jedoch anderes für den Fall gelten, wenn die Vergabe von Aufträgen nur als öffentlicher Auftrag erfolgen darf und der öffentliche Auftraggeber stattdessen rechtwidriger Weise einen anderen Auftragstyp, nämlich eine DLK wählt. Es ist vergleichbar wie bei De-facto-Vergaben auch in einem derartigen Fall Aufgabe der Vergabenachprüfungsinstanzen, die Einhaltung des Vergaberechts durchzusetzen. Soweit demnach die Vergabe eines Auftrags nur als ein dem Vergaberecht unterliegender Dienstleistungsauftrag und nicht als DLK vergeben werden kann, sind die Vergabenachprüfungsinstanzen zuständig. Insofern hat das OLG Düsseldorf den Rechtsweg zu den Vergabenachprüfungsinstanzen für zulässig erklärt, jedoch die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen.
OLG Düsseldorf: Alttextilentsorgung als Dienstleistungskonzession (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 07.03.2012 – VII Verg 78/11)
§ 99 Abs. 1, 4; Art. 1 Abs. 4 Richtlinie 2004/18/EG
 Dienstleistungskonzessionen unterfallen nicht dem förmlichen Vergaberecht. Dies bedeutet, dass die vergaberechtlichen Nachprüfungsinstanzen unzuständig sind und nur ein eingeschränkter Primärrechtsschutz vor den Zivil- oder Verwaltungsgerichten gewährt wird. Zudem haben Vergabestellen bei Vergabe einer Dienstleistungskonzession allenfalls die Grundsätze des Vergaberechts zu beachten. Vor diesem Hintergrund sind in letzter Zeit auch im Entsorgungsbereich Konzessionen vergeben worden. Im Rahmen von Altpapiervergaben hat der Bundesgerichtshof bereits im Jahre 2005 festgestellt, dass die Vermarktung bzw. auch der Verkauf von Altpapier keine ausschreibungsfreie Dienstleistungskonzession darstellt. Jüngst hat nunmehr das Oberlandesgericht Düsseldorf eine Ausschreibung zur Alttextilentsorgung als Dienstleistungskonzession angesehen. Dies eröffnet neue Spielräume für Dienstleistungskonzessionen bei der Vermarktung von Wertstoffen und somit auch in der Altpapierentsorgung.
Dienstleistungskonzessionen unterfallen nicht dem förmlichen Vergaberecht. Dies bedeutet, dass die vergaberechtlichen Nachprüfungsinstanzen unzuständig sind und nur ein eingeschränkter Primärrechtsschutz vor den Zivil- oder Verwaltungsgerichten gewährt wird. Zudem haben Vergabestellen bei Vergabe einer Dienstleistungskonzession allenfalls die Grundsätze des Vergaberechts zu beachten. Vor diesem Hintergrund sind in letzter Zeit auch im Entsorgungsbereich Konzessionen vergeben worden. Im Rahmen von Altpapiervergaben hat der Bundesgerichtshof bereits im Jahre 2005 festgestellt, dass die Vermarktung bzw. auch der Verkauf von Altpapier keine ausschreibungsfreie Dienstleistungskonzession darstellt. Jüngst hat nunmehr das Oberlandesgericht Düsseldorf eine Ausschreibung zur Alttextilentsorgung als Dienstleistungskonzession angesehen. Dies eröffnet neue Spielräume für Dienstleistungskonzessionen bei der Vermarktung von Wertstoffen und somit auch in der Altpapierentsorgung.
Rechtsschutz für Konkurrenten um die Vergabe von Energiekonzessionsverträgen
Ein Gastbeitrag von Dr. Stefan Meßmer, Menold Bezler Rechtsanwälte
 Die Vergabe von Konzessionen für den Betrieb von örtlichen Strom- und Gasnetzen steht derzeit im Fokus der deutschen Kartellbehörden und der Gerichte. Das Bundeskartellamt hat in mehreren Fällen den bereits erfolgten Abschluss von Konzessionsverträgen aufgegriffen, weil der Verdacht eines Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung der jeweiligen Kommunen, die den Konzessionsvertrag abgeschlossen hat, bestand. Demgegenüber sehen sich die Gerichte zunehmend mit Klagen von Konkurrenten konfrontiert, die sich gegen den geplanten Abschluss eines Konzessionsvertrags mit einem Wettbewerber wenden bzw. die Art und Weise der Gestaltung und Durchführung des wettbewerblichen Verfahrens zum Abschluss eines Konzessionsvertrags angreifen.
Die Vergabe von Konzessionen für den Betrieb von örtlichen Strom- und Gasnetzen steht derzeit im Fokus der deutschen Kartellbehörden und der Gerichte. Das Bundeskartellamt hat in mehreren Fällen den bereits erfolgten Abschluss von Konzessionsverträgen aufgegriffen, weil der Verdacht eines Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung der jeweiligen Kommunen, die den Konzessionsvertrag abgeschlossen hat, bestand. Demgegenüber sehen sich die Gerichte zunehmend mit Klagen von Konkurrenten konfrontiert, die sich gegen den geplanten Abschluss eines Konzessionsvertrags mit einem Wettbewerber wenden bzw. die Art und Weise der Gestaltung und Durchführung des wettbewerblichen Verfahrens zum Abschluss eines Konzessionsvertrags angreifen.
Die Rechtsform der Dienstleistungskonzession entscheidet über den Rechtsweg – zum Beschluss des BGH vom 23.01.2012 – X ZB 5/11
Ein Gastbeitrag von Dr. Christian P. Kokew, BEITEN BURKHARDT
 Die (beabsichtigte) Vergabe einer Dienstleistungskonzession kann nicht im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens von den Vergabekammern und den Vergabesenaten überprüft werden. Hierfür sind allein die Verwaltungs- und Zivilgerichte zuständig. Welcher Rechtsweg im Einzelfall eröffnet ist, richtet sich nach der Rechtsform der Dienstleistungskonzession. Wird dennoch ein Vergabenachprüfungsverfahren eingeleitet, haben die Vergabesenate das Verfahren nach § 17a Abs. 2 GVG an das Gericht des zulässigen Rechtsweges zu verweisen.
Die (beabsichtigte) Vergabe einer Dienstleistungskonzession kann nicht im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens von den Vergabekammern und den Vergabesenaten überprüft werden. Hierfür sind allein die Verwaltungs- und Zivilgerichte zuständig. Welcher Rechtsweg im Einzelfall eröffnet ist, richtet sich nach der Rechtsform der Dienstleistungskonzession. Wird dennoch ein Vergabenachprüfungsverfahren eingeleitet, haben die Vergabesenate das Verfahren nach § 17a Abs. 2 GVG an das Gericht des zulässigen Rechtsweges zu verweisen.
EuGH zur Abgrenzung von Dienstleistungsaufträgen zu -konzessionen im Verkehrsbereich (ÖPNV) – Urteil v. 10.11.2011, Rs. C-348/10
 Der EuGH hat mit Urteil vom 10.11.2011, Rs. C-348/10, erneut zur Abgrenzung von Dienstleistungsaufträgen und -konzessionen Stellung genommen, dieses Mal im Verkehrsbereich. Diese Abgrenzung ist für zahlreiche Wirtschaftsbereiche von zentraler Bedeutung und beschäftigt in zunehmendem Maß auch die Gerichte. Im Verkehrsbereich sind hier aus jüngster Vergangenheit die Entscheidungen des BGH vom 08.02.2011, X ZB 4/10, des OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.03.2011, VII-Verg 48/10, und des OLG München, Beschluss vom 22.06.2011, Verg 6/11, zu nennen, die sich ebenfalls u. a. mit der Abgrenzung von Dienstleistungsaufträgen, auf die die Vergaberichtlinien und die VOL/A anwendbar sind, und Dienstleistungskonzessionen, auf die neben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 primärrechtliche Grundsätze anwendbar sind, beschäftigt haben. Der EuGH nimmt in der vorgenannten Entscheidung vertiefend und abgrenzend zu den Merkmalen von Dienstleistungskonzessionen im ÖPNV Stellung.
Der EuGH hat mit Urteil vom 10.11.2011, Rs. C-348/10, erneut zur Abgrenzung von Dienstleistungsaufträgen und -konzessionen Stellung genommen, dieses Mal im Verkehrsbereich. Diese Abgrenzung ist für zahlreiche Wirtschaftsbereiche von zentraler Bedeutung und beschäftigt in zunehmendem Maß auch die Gerichte. Im Verkehrsbereich sind hier aus jüngster Vergangenheit die Entscheidungen des BGH vom 08.02.2011, X ZB 4/10, des OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.03.2011, VII-Verg 48/10, und des OLG München, Beschluss vom 22.06.2011, Verg 6/11, zu nennen, die sich ebenfalls u. a. mit der Abgrenzung von Dienstleistungsaufträgen, auf die die Vergaberichtlinien und die VOL/A anwendbar sind, und Dienstleistungskonzessionen, auf die neben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 primärrechtliche Grundsätze anwendbar sind, beschäftigt haben. Der EuGH nimmt in der vorgenannten Entscheidung vertiefend und abgrenzend zu den Merkmalen von Dienstleistungskonzessionen im ÖPNV Stellung.